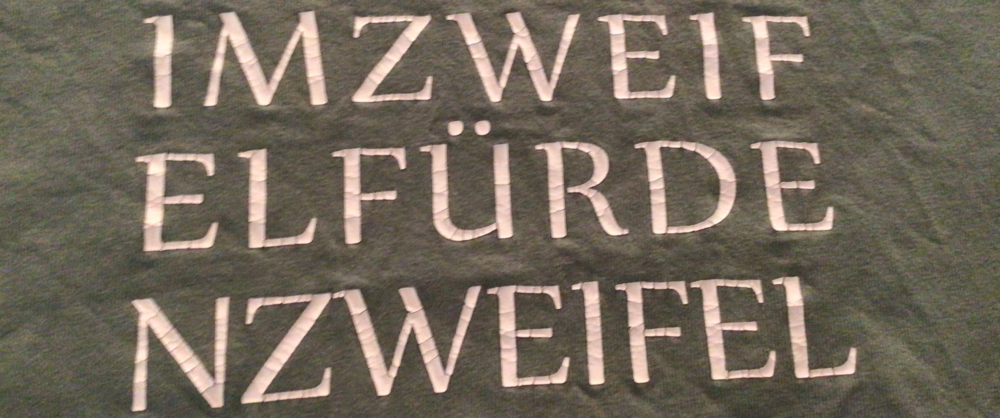Die Arbeit, das ist sonnenklar,
schmeckt uns Deutschen wunderbar.
Nur allzu häufig trauern wir,
ist sie erstmal verloren,
als wären wir, verdammt nochmal,
zum Arbeiten geboren.
So lange die Knechtschaft zum Benz hinreicht,
da sagt sich der Knecht: „Ach was, ich nehms leicht.“
Wird er nun verschoben zu früh auf die Halde,
dräuts ihm nun an, rufts aus dem Walde:
„Heute der Benz und morgen die Pacht.
Glücklich nur jene, die an der Macht.“
So zwingen wir uns, die Knechtschaft zu lieben,
und müssen vergessen, wie es ist, mit den Trieben.
Beseelt solln wir sein, so steht es geschrieben,
und gehts um Seele dann, heißts fesch: „Wir arbeiten dran.“
Wenn wir doch nur bemühten sie,
Träume, Sehnsucht, Phantasie,
fänden wir bald die Lichtung im Wald.
Nicht Arbeit, scheint es, sonderbar,
ist, was wir brauchen, leuchtend, klar:
wir sollten entwickeln ein prallvolles Innen,
das uns ermöglicht, mehr zu ersinnen:
Ideen, Orientierung, Bestreben, Gelingen.
Wenn das Außen so wegbricht, so ungnädig doll.
erfinden wir eben, wies weitergehn soll –
mit uns, der Arbeit, dem Land und der Welt.
Die Zukunft kommt immer, so oder so,
mit Arbeit kaum schlimmer als ohnehin so.
Den drängenden Vers, den end ich nun hier,
weil die Arbeit getan, geh ich auf ein Bier… :-))