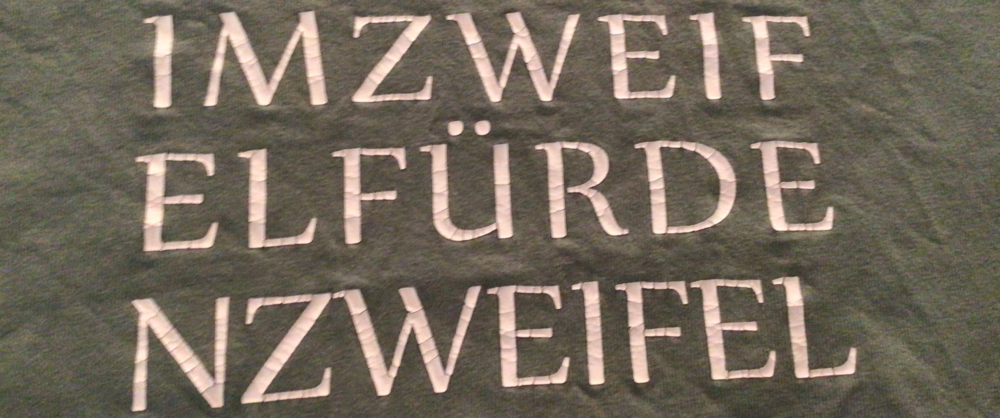|
Bernd Kalvelage Klassenmedizin – Plädoyer für eine soziale Reformation der Heilkunst Springer Heidelberg New York 2014 |
„Jeder Kranke benötigt eine ‚individuelle Medizin’, die seinen sozialen Status, seine Möglichkeiten und Grenzen kennt und berücksichtigt.“
Bernd Kalvelage war 30 Jahre lang Hausarzt im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg, einem so genannten „sozialen Brennpunkt“. Nach all seinen Erfahrungen hält er eine Behandlung „ohne Ansehen der Person“, so wie es eigentlich zum ärztlichen Selbstverständnis gehört, für keinen guten Ausgangspunkt der Heilkunst. Die Schichtzugehörigkeit seines Patienten unberücksichtigt zu lassen, hält er vielmehr für einen (Kunst-) Fehler, der dem Medizinbetrieb gar nicht mehr auffällt.
In seinem Buch „Klassenmedizin“ begründet der Autor ausführlich, warum das so ist: Der Medizinbetrieb habe den sozialen Blick auf die PatientInnen verloren, beklagt Kalvelage. Er belegt seine These akribisch, angereichert mit vielen Beispielen aus der eigenen Praxis, gewürzt mit scharfer Kritik an dem kläglichen Zustand der ärztlichen Selbstverwaltung und der totalen Durchökonomisierung des ärztlichen Handelns. Er hält einem Versorgungssystem den Spiegel vor, das es toleriert, dass Menschen aufgrund ihrer sozialen Lage früher sterben.
Neben dem somato-psychischen Blick auch noch an die soziale Situation der PatientInnen zu denken, stellt eine große Herausforderung dar. Doch im gegenwärtigen Versorgungssystem fehlt der Platz für eine Haltung, die meist unverschuldeten Notlagen der Menschen wirklich ernst zu nehmen. Dazu kommt, dass in Nachbarschaften wie Wilhelmsburg, in denen die Menschen körperlich und seelisch belasteter, also kränker sind, oftmals weniger Ärztinnen und Ärzte praktizieren. Und das obwohl gerade dort ein höherer Erklärungs- und Begleitungsbedarf besteht, um den Menschen die beste Medizin zu Verfügung zu stellen. Die Differenz in der Lebenserwartung zwischen der höchsten und niedrigsten Einkommensgruppe beträgt in Deutschland bei Männern ca. 11 Jahre und bei Frauen 8 Jahre. Diese Diskrepanz alleine unterschiedlichen und selbst verschuldeten Lebensstilen zuzuschreiben, greife zu kurz und sei außerdem zynisch, so Kalvelage. PatientInnen werden vom medizinischen Versorgungssystem in Deutschland für ihre soziale Lage bestraft. Es gilt das alte Bonmot „If you want to improve your health, change your social class“.
Kalvelage kritisiert die Zumutungen der gut situtierten Mehrheitsgesellschaft, bestimmten Kranken und Notleidenden mehr abzuverlangen als sie leisten können: Wieso wird von PatientInnen erwartet, die Verantwortung für das eigene Wohl und Wehe zu übernehmen, wenn sie davor nie in die Lage versetzt worden sind, diese Verantwortungsübernahme zu erlernen? Warum sollten PatientInnen selbstwirksam daran glauben, es läge in ihrer Macht zu gesunden, wenn sie alltäglich dem Gefühl von Ohnmacht, Abhängigkeit und ökonomischer Deprivation ausgesetzt sind?
Begriffe wie Shared-Decision-Making, Eigenverantwortung oder Primärprävention bilden zwar die modernen Trends der Fitness-Gesellschaft und deren Interessen ab, aber sie ignorieren, wie viele PatientInnen dabei auf der Strecke bleiben – im wahrsten Sinne des Wortes. Menschen in Not werden bewusst Ressourcen verweigert und ein abgehobener gesellschaftlicher Diskurs fordert mit „intellektuell beschlagener Oberschichtenbrille“ zur Erziehung der Unterschichten auf.
Wenn all das so ist, was bedeutet das für die hausärztliche Tätigkeit?
Der rote Faden des Buches ist die Einforderung einer bestimmten (haus)-ärztlichen Haltung: „Handle in deinem Verantwortungsbereich so, dass du mit dem Einsatz all deiner Ressourcen immer beim jeweils Letzten beginnst, bei dem es sich am wenigsten lohnt.“ Dieser Satz von Klaus Dörner ist auch für Kalvelage sein „kategorischer Imperativ“. Dabei erkennt er wie Dörner zunächst an, dass es sich dabei um eine Art kalkulierte Überforderung handelt. Der Handlungsmaxime dennoch zu folgen, bringt den handelnden Arzt klar in Stellung dagegen, die Schwächsten auszugrenzen. Mehr noch, die Haltung ist eine Kampfansage an die Ökonomisierung ärztlichen Handelns wie überhaupt des Sozialen.
Kalvelage will soziale Barrieren und Benachteiligungen überwinden. Das ist sein leidenschaftlicher Appell an uns Hausärztinnen und Hausärzte. Er möchte, dass wir uns dafür einsetzen, die Medizin vom Letzten her zu sehen. – Und das sei nicht nur als eine Bürde dem einzelnen Arzt im Sprechzimmer auferlegt, vielmehr müsse das gesamte Konzept medizinischer Versorgung dem Rechnung tragen, Klassenmedizin eben.
Als ein typisches Beispiel führt der Autor die Leitlinien an, die nach wie vor auf eine ausschließlich rationale Steuerung von Menschen setzen. Wo finden wir Hinweise auf die schichtabhängige Umsetzbarkeit von Therapiezielen, auf eine notwendige Orientierung an den Möglichkeiten eines Patienten, der in seinem ganzen Leben so etwas wie Selbstwirksamkeit kaum erfahren hat, auf verkürzte Lebenserwartung, weil eben Zugangshürden unüberwindbar geworden sind? Wo finden wir Ermunterung zur partizipativen Entscheidungsfindung, die Therapiewiderstände berücksichtigt und sich mit kleinen, bescheidenen Therapiezielen zufrieden gibt?
Er fordert Freiraum für eine so verstandene ärztliche Tätigkeit und sieht unsere Gesellschaft auf der schiefen Ebene, weil sie dabei ist, die Kontrolle über die Heilkunde zu verlieren – und sie an Ökonomen und Verwaltungsbürokraten abzugeben. Er möchte die Ärzteschaft wieder für ihren Kernauftrag sensibilisieren und sieht die HausärztInnen in besonderer Weise gefordert, da nur sie sich über die Beziehung zu ihren PatientInnen definieren. HausärztInnen erleben hautnah, wie sehr sich der moderne Medizinbetrieb mit seinen standardisierten Regelungen und Abläufen von den Bedürfnissen der PatientInnen entfernt hat.
Fazit
Bei „Klassenmedizin“ handelt es sich um ein Buch, auf das sich die geneigte Leserin und der geneigte Leser einlassen muss. Es ist fundierte, immer wieder empirisch und anekdotisch untermauerte Gesellschafts- und Medizinkritik. Es ist politisch, philosophisch und gleichzeitig sehr persönlich. Es macht uns die Kernaufgaben deutlich, hält uns den Spiegel vor, zwingt zum Nachdenken. Insofern ist das Buch riskant für die Lesenden: Kalvelages Blick zu folgen, bedeutet, zukünftig nicht mehr weg- oder vorbeischauen zu können. Denn wer sich einmal darauf eingelassen hat, kann in seinem Denken nicht mehr hinter die Perspektive zurück, die Kalvelage in aller Deutlichkeit und mit aller Dringlichkeit ausbreitet. – Auch wenn Kalvelages politische Haltung eher auf der linken Seite des politischen Spektrums verortet werden kann, ist das Werk gerade kein Buch für Linke oder nur für Ärztinnen und Ärzte in sozialen Brennpunkten mit ihren spezifischen Arzt-Patient-Konstellationen. Im Kern geht es Kalvelage ja um die ärztliche Haltung, nicht um die politisch-ideologische. Egal ob freiberuflich oder angestellt – ein Arzt ist nicht der KV, dem Controlling, nicht den Chefs, nicht den Krankenkassen, auch nicht seiner Einkommensmaximierung, sondern nur guter Medizin und den PatientInnen verpflichtet.
Mahnend erinnert uns Kalvelage, dass unsere professionelle Autonomie an eine zentrale Bedingung geknüpft ist: die ausschließliche Orientierung am Wohl unserer PatientInnen, der Not des Menschen, der vor uns sitzt. Der Autor entreißt uns dem Klammergriff der Ökonomie, zunächst einmal intellektuell. Er macht uns den Kopf frei und gibt uns unsere Unabhängigkeit zurück: Der ärztliche Auftrag ist nicht verhandelbar. Wir sind unverfügbar. Wir sind keine Dienstleister. Wir sind Treuhänder für die Sorgen und Nöte unserer PatientInnen.
Die Lektüre dieses Buches kann selbst HausärztInnen nach langjähriger Tätigkeit sehr nachdenklich zurücklassen. Es braucht wesentlich mehr Mut und Engagement, nicht nur um die „Klassenmedizin“ anzuwenden, sondern um einer derartigen Re-Sozialisierung der Medizin deutlich mehr Gehör zu verschaffen – innerhalb unserer eigenen Profession, in Politik und Gesellschaft.