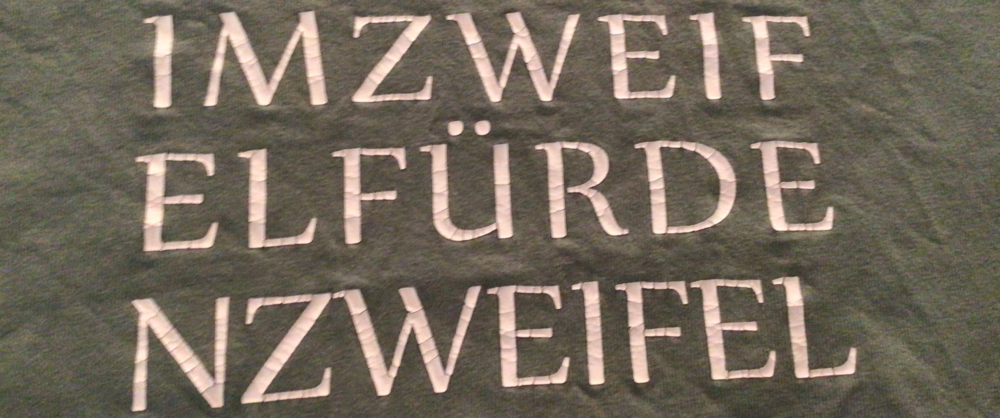Kaum zu glauben, wie schnell sich die Dinge manchmal entwickeln. Hätte Karl Lauterbach wieder einmal gefordert, die private Krankenversicherung (PKV) abzuschaffen, wäre das für keinen Redakteur eine Nachricht gewesen.
Da diesmal die Versicherungskonzerne Allianz, Axa und Co., also Teile der privat organisierten Versicherungswirtschaft selber mit solchen Ideen in Verbindung gebracht werden, überschlagen sich die Reaktionen.
Die SPD freut sich, die Grünen begrüßen, die Union sieht sich “friendly fire” ausgesetzt – ausgerechnet die Privatversicherer wollen eine Einheitsversicherung! Die Bundesärztekammer distanziert sich, die gesetzlichen Krankenkassen lehnen es ab. Und die Versicherer? Spielen nur Reformszenarien durch: “Die Versicherer sehen sich jedoch in der Pflicht, den politischen Diskurs mit fachlichem Wissen und Rat zu unterstützen. Dazu gehört auch das interne Durchspielen möglicher Reformszenarien.”
Doch ist die PKV als System überhaupt zu retten? Schon heute arbeitet die Branche unter stark erschwerten Voraussetzungen. Die Gegner der PKV (Lauterbach und ein paar andere) haben gute Arbeit geleistet, den Unternehmen einerseits die Kunden vorzuenthalten und andererseits Pflichttarife von ihnen zu verlangen.
Zum einen dürfen seit der letzten GKV-Reform nur noch jene Angestellten in die PKV wechseln, deren Einkommen mindestens drei Jahre lang oberhalb der Versicherungspflichtgrenze liegt. Zum anderen zwingt die Politik den Unternehmen einen risiko- und altersunabhängigen Basistarif auf, der allen privat Versicherten angeboten werden muss. Der Tarif enthält alle Leistungen, die auch in der GKV als Regelleistungen erbracht werden.
Schließlich sollen die Versicherten ein Wechselrecht erhalten, bei dem sie ihr angespartes Kapitel mit in die neue Versicherung einbringen können. Dagegen bringen sich die Unternehmen gerade mit einigem Erfolg in Stellung.
Dennoch: Langfristig sieht es nicht gut aus für die private Kranken(voll)versicherung. Genausowenig gut wie für die gesetzliche Kranken(voll)versicherung. Zwei Wege bieten sich an, die finanziellen Probleme anzugehen: Verbreiterung der Einnahmebasis, Verringerung des Leistungsangebots. Das System braucht mehr Geld (aus Steuern, Kapital, Beiträgen) und muss dennoch seine Leistungen für alle beschränken.
Weil die Möglichkeiten so vielfältig geworden sind, ja, weil die Medizin in Teilen so gut geworden ist, beansprucht sie zu viele gesellschaftliche Ressourcen. Deswegen könnte es ein Weg sein, einen möglichst umfassenden Grundkatalog zu erfinden und breit gesellschaftlich zu diskutieren – und einen Katalog vorzuhalten, der zusätzlich abgesichert werden müsste (Stichwort Risiko Unfälle: Skifahren, Fußball spielen, etc.)
Die Debatte zu beginnen, dafür wäre gegenwärtig der richtige Zeitpunkt.