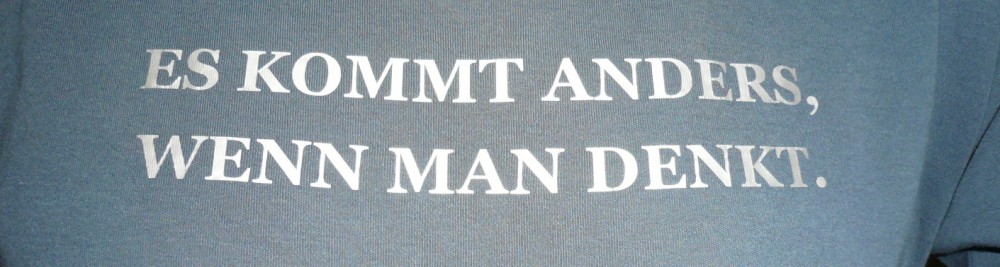Gastbeitrag von Nicola Wessinghage. Text veröffentlicht im Weblog InKladde am 26. Nov. 2015.
Ali Hassan und sein Neffe Hussam Hamad aus Syrien haben Ende August die Flucht nach Deutschland geschafft. Warum es ihnen bis jetzt noch nicht vergönnt ist, wirklich in Hamburg anzukommen.
Leider ist es ja vermutlich nur einer von vielen Fällen, in denen die deutsche Bürokratie in der aktuellen Flüchtlingskrise unglaubliche Geschichten schreibt. Umso wichtiger, sie zu erzählen und die ganze Absurdität im Konkreten zu zeigen.
Es ist die Geschichte des 32jährigen Ali Hassan und seines neunjährigen Neffen Hussam Hamad. Ende August kamen die beiden aus Syrien nach Deutschland. Registriert wurden sie am 14. September in der Erstaufnahme Asyl/Flüchtlinge in der Harburger Poststraße. Hier erfuhren sie, was geschehen sollte: Die Hamburger Behörden wollten sie trennen. Nach dem aktuellen Quotensystem wiesen die Behörden Ali Hassan Friedland in Niedersachsen zu. Sein Neffe Hussam dagegen ist in den Augen der Ausländerbehörde ein unbegleiteter Minderjähriger – mit diesem Status sollte er in Hamburg bleiben.

Fotos: NDR Hamburg Journal
Was die Behörde sagt:
“Herr Ali Hassan hat keinen Anspruch auf eine Zuweisung nach Hamburg… Da Hussam nicht von einem Erziehungsberechtigten begleitet worden ist, gilt er als minderjähriger unbegleiteter Flüchtling.”
Eine Abweichung vom Quotensystem und damit die Erlaubnis, dass Ali Hassan in Hamburg bleiben kann, will die Behörde bis heute nicht gewähren.
Hilfe in der Notsituation
Einem engagierten Menschen, Fathi Abu Toboul vom Verein “Deutsch-Jordanische Gesellschaft”, ist es zu verdanken, dass zumindest die Trennung der beiden bis heute verhindert werden konnte. Fathi beriet die beiden und empfahl Ali, die Unterschrift unter dem Asylantrag zunächst zu verweigern. Die NDR-Journalistin Lara Straatmann berichtete über Ali und Hussam im NDR-Hamburg-Journal. Durch den Beitrag wurde eine Hamburgerin auf das Schicksal der beiden aufmerksam, die Onkel und Neffe spontan bei sich zuhause aufnahm. Es war eine Vorsichtsmaßnahme, um sie dem Zugriff der Behörden zu entziehen und damit ihre Trennung zu verhindern. Inzwischen leben die beiden in einem Zimmer in einem Hamburger Wohnprojekt.
Allen Beteiligten war klar, dass das, was die Behörden vorhatten, auf jeden Fall verhindert werden musste: Die beiden durften nicht getrennt werden, auch nicht für einen einzigen Tag.
Fathi, der Betreuer, sagt:
„Sie haben alles überlebt, sie haben es geschafft, nach Deutschland zu kommen – und jetzt sollen sie hier getrennt werden!“
Traumatisiert durch Erlebnisse in Syrien
Man muss nicht die ganze Geschichte der beiden kennen, um zu ahnen, was eine Trennung für Hussam bedeuten würde, was sie in ihm anrichten würde. Durch die Flucht aus Syrien und die Erlebnisse in seiner Heimat ist er bereits traumatisiert. Es ist nicht auszudenken, wie er es erleben würde, wenn man ihm seinen Onkel nimmt.
Ali sagt:
„Ich habe seiner Mutter versprochen, immer auf ihn aufzupassen. Seine Schwestern sind noch in Damaskus. Wir waren wochenlang zu Fuß unterwegs. Deutschland hilft doch den Syrern – warum das? Ich kann ihn doch nicht alleine lassen!“
Hussams Vater ist vor etwa zwei Jahren bei einem Bombenangriff auf das Flüchtlingslager Jarmuk in Damaskus ums Leben gekommen. Auch sein Onkel Ali lebte dort seit seiner Geburt, seine Eltern waren aus Palästina nach Syrien geflüchtet. Das Lager ist nacheinander von Assads Truppen und dem IS belagert worden, die Süddeutsche schreibt von „der Hölle auf Erden“.
Nach dem NDR-Beitrag und einem weiteren Bericht auf RTL-Nord sah es zunächst so aus, als würden die Behörden Einsicht zeigen. Ali konnte ein beglaubigtes Schreiben von Hussams Mutter vorweisen, die ihm die Vormundschaft überträgt. Es sollte sich nur noch um Tage handeln, so dachte Fathi, dachte die Frau, die sie aufgenommen hatte, dachten die Bewohner des Wohnprojekts, die ein freies Zimmer angeboten hatten, um die restlichen Tage bis zur endgültigen Entscheidung zu überbrücken
So dachten aber vor allem Ali und Hussam. Für sie bedeutet die offizielle Anerkennung als Flüchtlinge alles: Sie brauchen sie, um Papiere zu bekommen, Leistungen beziehen zu können, um offiziell krankenversichert zu sein. Sie brauchen den Flüchtlingsstatus aber vor allem, um einen Antrag stellen zu können auf den Nachzug ihrer Familienangehörigen: Hussams Mutter, seine Geschwister und Alis Ehefrau, die ebenfalls in Jarmuk lebt. Alle sind in dem Lager großen Gefahren ausgesetzt, jeden Tag riskieren sie ihr Leben bei weiteren Angriffen. Hussams Mutter ist tief verzweifelt darüber, nach dem Tod ihres Mannes nun auch noch von ihrem Sohn getrennt zu sein.
Quälendes Warten
Inzwischen warten Ali und Hussam und die Menschen, die sich hier in Deutschland um sie sorgen, schon über zwei Monate. Tagtäglich fragen sich die beiden und ihre Unterstützer/innen sich, warum nichts passiert. Weder wurden zwei Eingaben an die Bürgerschaft bearbeitet, die Fathi Abu Toboul und eine der Hamburger Wohnungsgeberinnen verfasst hatten. Noch gab es Rückmeldungen zu den Anträgen auf Krankenkassen- und Sozialleistungen.
Erste Schritte zur Integration
Das einzige, was in Hamburg funktioniert: Hussam geht seit Mitte Oktober in eine Aufnahmeklasse an einer Grundschule. Er macht sehr gute Fortschritte in Deutsch, seine Lehrerin ist begeistert von ihm und will sich ebenfalls dafür stark machen, dass er mit seinem Onkel in der Stadt bleiben kann. Hussam spielt Schach und Karten mit den Kindern, die in dem Haus wohnen, in dem er nun seit Wochen mit seinem Onkel lebt. An Halloween ist er verkleidet mit ihnen durchs Viertel gezogen. Die Bewohner sorgen gemeinsam dafür, dass die beiden das bekommen, was sie zum Leben brauchen, dass sie gesundheitlich versorgt werden. Ali Hassan litt wochenlang unter heftigem Zahnschmerzen. Ohne irgendeinen Nachweis in der Hand war es ein großer Aufwand, einen Arzt zu finden, der ihn behandeln wollte.
Gemeinsam mit Fathi und der ersten Wohnungsgeberin bündeln nun die Unterstützer/innen aus dem Wohnprojekt ihre Kräfte dafür, dass Ali und Hussam endlich offiziell in Hamburg leben dürfen – zusammen. Alle Beteiligten sehen, wie belastend die Situation für die beiden ist, wie sehr vor allem Ali das Warten lähmt und er immer mehr daran verzweifelt, nichts unternehmen zu können.
Ali sagt:
“Ich bin mein ganzes Leben lang ein Flüchtling gewesen. Hier fühle ich mich wie ein Flüchtling zweiter Klasse. Jeden Tag, an dem ich wach werde, hoffe ich, dass er bald vorbei geht – bis endlich etwas geschieht. Die Zeit läuft und nichts ändert sich für uns. Es ist so gut, dass wir hier aufgenommen wurden und Hilfe erhalten, aber warum ist das notwendig? Warum dürfen wir hier nicht leben wie alle anderen Flüchtlinge auch?”
Hussam sagt:
“Ich fühle mich sicher hier, ich gehe zur Schule, ich habe sogar schon Freunde gefunden. Aber ich vermisse meine Mutter und Geschwister sehr. Ich habe große Angst, dass ihnen etwas passiert. Ich wünsche mir sehr, dass sie auch nach Deutschland kommen können!”
Fathi sagt:
“Die Menschen in Deutschland engagieren sich sehr dafür, dass die Flüchtlinge hier gut aufgenommen werden. Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist sehr beeindruckend. Aber die Behörden machen das kaputt, wenn sie in Fällen wie bei Ali und Hussam nur die Bürokratie regieren lassen.”
Eine Bewohnerin des Hauses sagt:
“Bei allem Verständnis für die hohe Belastung in den Behörden: Wie kann man nur auf die Idee kommen, diese beiden Menschen zu trennen? Warum gibt es keinen Widerstand bei den Mitarbeitern gegen eine Regelung, die so etwas vorsieht? In diesen Tagen ist Bürokratieabbau mehr denn je gefragt. Wir erwarten von den Behörden, dass sie hier die Menschen sehen und nicht die Vorschriften. Sie hätten sogar rechtliche Grundlagen dafür*.
Wir werden nicht zulassen, dass man die beiden trennt. Wir möchten nicht länger unsere Kraft dafür verschwenden, GEGEN eine irrsinnige Regelung anzugehen. Wir möchten uns endlich DAFÜR engagieren, dass diese beiden Menschen hier richtig ankommen können und ihre Familie hoffentlich bald nachziehen wird.“
*Inzwischen gibt es neben einer UN-Kinderrechtskonvention, die für Vertragsstaaten den Schutz der Familie vorsieht, auch ein Gesetz, das zum 1.11. erlassen worden ist: In § 42a (5) heißt es dort:
„Hält sich eine mit dem Kind oder dem Jugendlichen verwandte Person im Inland oder im Ausland auf, hat das Jugendamt auf eine Zusammenführung des Kindes oder des Jugendlichen mit dieser Person hinzuwirken, wenn dies dem Kindeswohl entspricht.“
Absurderweise haben viele Menschen im Augenblick die Sorge, dass nicht das Zusammenbleiben, sondern im Gegenteil die Trennung das ist, worauf die Ausländerbehörde „hinwirkt“.