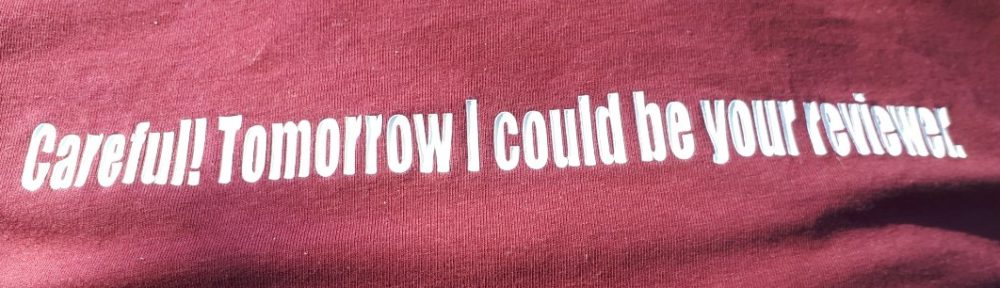Letzte Woche verkündete Forschungsministerin Schavan, der Bund wolle ein Art Nationales Demenzzentrum gründen.
Die Initiative beruht auf einer Ankündigung aus dem vergangenen Jahr, ein Institut ins Leben zu rufen, das die Betreuung und Versorgung der Demenzkranken im Land stärkt. Es sollte die Krankheitsursachen, Möglichkeiten der Prävention und Früherkennung, die Entwicklung wirksamer Therapien und die Untersuchung der psychosozialen Folgen von Demenzen erforschen. Frau Schavan damals: „Es geht auch um die besten Formen der Pflege und Versorgung. Die Forschung für den Menschen steht im Mittelpunkt.“
Und was ist in der vergangenen Woche daraus geworden? Ein umgetauftes Zentrum für sämtliche neurodegenerativen Erkrankungen. Eine Kommission, die ausschließlich aus Grundlagenforschern und einer Pflegewissenschaftlerin besetzt ist. Faktisch eine Kungelrunde, die (vor)-ausgewählte Forschungseinrichtungen einlädt, die 60 Millionen Euro jährlich unter sich zu verteilen.
Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin (DEGAM) kritisiert die Pläne der Ministerin:
„Grundlagenforschung ist fraglos nötig und die auserwählten Wissenschaftler sicherlich qualifiziert. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Konzeption des Instituts einseitig ausgerichtet ist. Die Grundlagenforschung kann auf absehbare Zeit weder den heute Erkrankten, noch ihren Angehörigen bzw. denjenigen nutzen, die jeden Tag die Last der Versorgung tragen. Zur Lösung dieser alltäglichen Versorgungsprobleme, die gleichwertig auf der Agenda des Instituts stehen muss, kann die Mehrzahl der Kommissionsmitglieder jedoch schon deswegen nicht beitragen, weil sie damit keine Erfahrungen hat.“
Leider macht das ganze Verfahren (Ankündigung, Entscheidung über Vergabe innerhalb der kommenden vier Wochen, Einladungen an vorab informierte medizinische Fakultäten, die Kommissionsbesetzung) den schlechten Eindruck, für Frau Schavan und die auserwählten Wissenschaftler stünde das Labor im Mittelpunkt, keineswegs aber der Mensch.