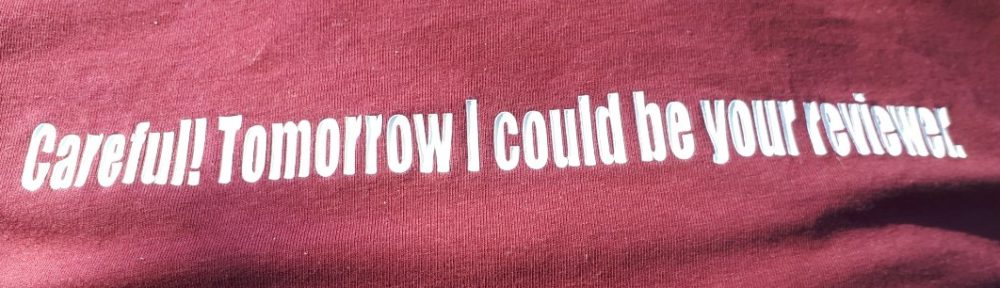Erschienen in der tageszeitung am 27.02.2003
Die freie Arztwahl gehört zu den Grundfesten des deutschen Gesundheitssystems. Doch die Erfahrung zeigt: Sie schadet den PatientInnen und treibt die Kosten in die Höhe
Wenn der Bauch wehtut oder der Kopf dröhnt, wenn Glieder oder Muskeln schmerzen, dann geht man zum Arzt. Die meisten PatientInnen sind in solchen Fällen fest davon überzeugt, dass mit ihrem Körper „irgendetwas nicht stimmt“. Denn in unserer Kultur ist es fast zwingend, für solche Leiden den Körper verantwortlich zu machen.
Das Problem ist nur: Bei knapp einem Drittel aller PatientInnen lassen sich keine organischen Ursachen für die Erkrankung feststellen – und das gilt selbst, wenn sich stark beeinträchtigende körperliche Symptome zeigen. In den Facharztpraxen für Kardiologie, Neurologie oder auch Orthopädie wird sogar nur die Hälfte der Symptome als organisch verursacht erklärt.
Gelingt es der Ärztin in diesen Fällen nicht, die PatientInnen von der meist fixen Idee einer körperlichen Ursache abzubringen, droht Doktor-Hopping: Auf der Suche nach einer organischen Ursache lassen sich PatientInnen mit solch einer „funktionellen Symptomatik“ häufiger untersuchen, stärker invasiv behandeln und unter größerem Kostenaufwand laboranalytisch vermessen als die durchschnittliche PatientIn einer Praxis. Im Zweifel gilt offenbar: Kommt es zu einer „Diagnose ohne Befund“, liegt die nächste Praxis nicht weit – der freien Arztwahl sei Dank.
Diese freie Arztwahl gehört zu den Grundfesten des deutschen Gesundheitssystems. Doch: Sie schadet den PatientInnen und treibt die Kosten in die Höhe. Das lässt sich vor allem an den Beschwerden vorführen, für die sich keine organischen Ursachen feststellen lassen, da sie zu den größten Kostenblöcken im Versorgungssystem gehören. Doch die daraus resultierenden Probleme des Gesundheitssystems lassen sich im Wesentlichen auf alle Krankheiten übertragen.
Problematisch am Doktor-Hopping ist, dass jede aufgesuchte Ärztin einen anderen Namen für die Beschwerden erwähnt – und zwar in Abhängigkeit vom eigenen Fachgebiet: Was für die Internistin wie ein Reizdarm aussieht, stellt sich der Rheumatologin wie ein Weichteilrheumatismus dar. Und nur in Ausnahmefällen kommt es tatsächlich irgendwann zu einem körperlichen Befund.
Die Konsequenzen einer solcherart organisierten Versorgungsstruktur sind offensichtlich: PatientInnen mit funktioneller Symptomatik sind zwar ökonomisch wertvoll, aber dennoch nicht unbedingt gern gesehen. Sie gelten oft als schwierig oder sogar querulatorisch und erweisen sich gelegentlich als absolut beratungsresistent.
Die vorsichtige Nachfrage der Ärztin, ob eventuell auch Stress oder sonstige psychosoziale Belastungen für die Symptome verantwortlich gemacht werden könnten, quittieren sie mit der Gegenfrage, ob die Medizinerin meine, sie seien verrückt – im besten Fall. Im schlechtesten Fall verlieren solche MedizinerInnen ihre Kundschaft. Die freie Arztwahl beschleunigt solche Beziehungsabbrüche, wenn sich die Medizinerin nicht den Kundenwünschen und -erwartungen gemäß verhält.
Ohne Zweifel hat sich das Verhalten der PatientInnen in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch verändert: Sie sitzen im Schnitt häufiger in einer Arztpraxis. Sie gehen wegen leichterer Beschwerden in die Sprechstunde. Sie sind weniger bereit als frühere Generationen, ein aus dem Gleichgewicht geratenes körperliches Befinden längere Zeit zu tolerieren. Gesundheit ist in diesem Sinne zu einer Ware geworden, die sich erwerben lässt, wenn sie nach subjektivem Ermessen (scheinbar) abhanden gekommen ist.
Darüber hinaus sind Schmerz und körperliches Leiden stark soziokulturell überformt. Die jeweilige Kultur entscheidet etwa, ob der Geburtsschmerz allein der Frau, allein dem Mann oder beiden zusteht. Die Individuen der postmodernen Industriegesellschaften allerdings akzeptieren nur noch die Abwesenheit jeglicher unangenehmer Empfindungen als wünschenswerten Wohlfühlzustand. Wer unter einer Beschwerde leidet und deshalb von Krankheitsängsten geplagt wird, versucht möglichst frühzeitig durch den Besuch bei mindestens einer Expertin zu klären, was man dagegen tun könne.
Die freie Wahl einer Ärztin verstärkt diese konsumistische Haltung. Der Körper und das körperliche Erleben zerfällt in seine funktionsfähigen und nicht funktionsfähigen Einzelteile, deren Reparaturbedarf in freier Entscheidung einer entsprechenden Spezialistin überantwortet wird. Schmerzt ein Gelenk, ist entweder die Orthopädin oder die Rheumatologin zuständig, schmerzt der Kopf, wird die Neurologin tätig – oder auch die Hals-Nasen-Ohren-Ärztin.
Das wäre nicht weiter schlimm, wenn die Selbstüberweisung der PatientInnen an eine behandelnde Spezialistin mit den möglichen Ursachen einer körperlichen Funktionsstörung in Einklang stünde. Doch die Entscheidung, eine bestimmte Expertin aufzusuchen, um Beschwerden abzuklären, beruht auf ausgesprochen unzuverlässigen Vermutungen darüber, in welchem Organsystem die Ursache für die Störung zu suchen sein könnte. Die Erfahrung lehrt: Dort, wo es wehtut, liegt in den seltensten Fällen die Ursache für den Schmerz.
Allein dies reichte als Grund schon aus, der Hausärztin größeres Gewicht in der Erstversorgung der Patientin zuzugestehen. Beide könnten dann gemeinsam herausfinden, welche weitere Abklärung der Beschwerden sinnvoll und notwendig sein könnte – so wie es auch Gesundheitsministerin Ulla Schmidt fordert. Doch damit nicht genug. Das häufige Phänomen, verschiedene MedizinerInnen aufzusuchen, um mehrere „unabhängige“ Meinungen in Erfahrung zu bringen, birgt weitere Gefahren für die Gesundheit.
Zum einen wird der Glaube an eine organische Ursache verfestigt. Zum anderen wachsen Verwirrung und Verunsicherung aufseiten der PatientInnen. Jede Spezialistin kauderwelscht nämlich der Betroffenen zwischen Tür und Angel ein paar lateinische Worte ins Ohr – und empfiehlt dieses oder jenes Präparat und eine Wiedervorstellung, wenn die Beschwerden sich nicht bessern.
Gleichzeitig führen die verschiedenen Medikamente, die unabhängig verschrieben, aber nun gemeinsam eingenommen werden, zu Nebenwirkungen, die wiederum kaum kontrollierbar sind. Oft hat die Patientin dann den Eindruck, die ursprünglichen Beschwerden verschlimmern sich. Die Folge: Sie sucht eine weitere Ärztin auf. Ein Teufelskreis.
Das vielstimmige Konzert ärztlicher Meinungen und deren unabhängig voneinander verordnete Verschreibungen gefährden die Gesundheit der PatientInnen. Deswegen erwiese es sich als außerordentlich konstruktiv, das hausärztliche Lotsenmodell aus dem Hause Schmidt gegen den Widerstand der betroffenen SpezialistInnen politisch durchzusetzen. Das ideologisch überfrachtete Gut der freien Arztwahl zu opfern scheint ein kleiner Preis, verglichen mit dem Gewinn, der daraus erwüchse: besser versorgte PatientInnen.