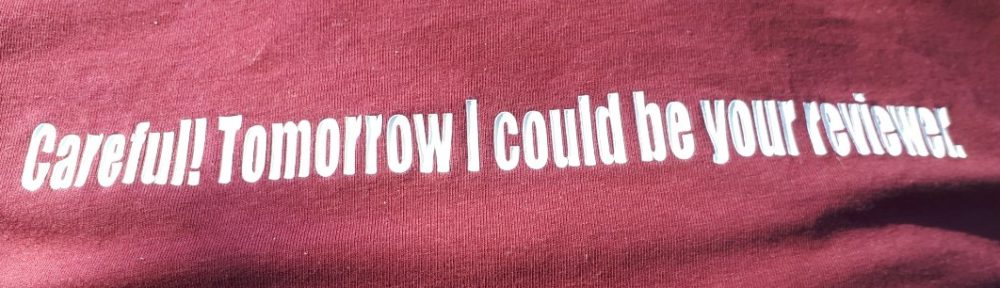Am Mittwoch letzter Woche (05.03.08) ist der Hacker, Computerphilosoph und Gesellschaftsanalytiker Joseph Weizenbaum gestorben. Ich habe ihn 1998 besucht, um ihn für die Zeitschrift Psychologie Heute (Heft 12/98) zu interviewen. Ich veröffentliche das ausführliche Gespräch erneut, verteilt über vier Blogeinträge. Es hat wenig von seiner Aktualität eingebüßt, obwohl es entstanden ist, bevor Internet, Handy und Laptop zu wirklichen Massenphänomen wurden. Zeitlos also das Gespräch, trotz der rasanten Entwicklungen gerade in diesem Bereich und ein Zeichen dafür, wie werthaltig Weizenbaums Betrachtungen sind.
Teil 3 12.03.08, Fortsetzung:
Zettmann: Der Erfolg führt uns in das Dilemma, daß der Computer menschliche Tätigkeiten und damit Fähigkeiten und Fertigkeiten entweder entwertet oder gänzlich abschafft.
Weizenbaum: Es mußte so kommen und es war schon lange absehbar, wenn man sich schon früher kritisch damit auseinandergesetzt hätte. Ich habe an der Wayne-University in Detroit studiert. Dort habe ich 1951 meinen ersten Computer zusammengebaut. Damals bin ich mit einigen anderen Assistenten zur Automobilgewerkschaft gegangen, um den Leuten zu sagen, daß der Computer die gesamte Branche verändern wird. Darauf sollten sie vorbereitet sein. Wir nahmen uns damals die entsprechende Zeit, um kritisch über die Auswirkungen solcher Entwicklungen nachzudenken. Wer sollte die Kritik sonst ausüben, wenn nicht jene Leute, die mit diesen Dingen arbeiten?
Angesichts meiner kritischen Haltung werde ich oft gefragt, wie ich weiter lehren kann? Denn ich lehre Computersprachen und die werden dann in Waffensystemen verwendet. Wie kann ich das vertreten, werde ich gefragt. Aber es ist ganz einfach: Wir brauchen Leute, die den Computer und die kritisch damit umgehen und darüber nachdenken kann. Wer sonst? Am besten ist es, die kritische Herangehensweise von Lehrern zu vermittelt zu bekommen, die durch ihre Haltung etwas Tiefe rüberbringen.
Z: Gibt es so eine Art innerer psychischer Bereitschaft, all den Versprechungen der Industrie zu glauben – und eben nicht kritisch zu hinterfragen.
W: Ich glaube ja, so eine Bereitschaft gibt es, denn das hat auch etwas mit Wünschen zu tun: Man wünscht sich, daß das Leben leichter wird. Aber es hat auch etwas mit einer Art emotionaler und intellektueller Faulheit zu tun. Das Leben ist leichter, wenn wir uns nicht mit solchen Dingen beschäftigen. Vielleicht müßte man sich irgendwann einmal bemühen, nicht an diese fürchterlichen Sachen zu denken. Wenn man etwas nicht sehen will, dann sieht man es nicht, auch wenn es da ist – selektive Wahrnehmung. Wenn man sich daran gewöhnt hat, nicht zu sehen, wenn man einfach Harmonie haben möchte…
Ich glaube der Wunsch, in Frieden gelassen zu werden, auch sich selber in Frieden zu lassen, eben nicht an solche Sachen zu denken, die das innere Gleichgewicht stören, ist sehr weit verbreitet. Man lebt allerdings auf einer trivialen Ebene. Der Preis wird jedoch schließlich sehr hoch. Sie sehen das in der Welt: Wir entwickeln uns von einer Krise zur anderen. Der amerikanische Präsident Johnson hat damals die Öffentlichkeit über die Kosten des Krieges in Vietnam belogen. Hätte er die Wahrheit gesagt, hätte die Bevölkerung wohl gesagt, nein, wir brauchen das Geld für andere Sachen, das Engagement ist teuer – unabhängig davon, ob der Krieg gerechtfertigt werden kann oder nicht. Zu Lügen war das einfachste zu tun, denn es störte die Menschen nicht in ihrer Ruhe auf. Warum reden wir überhaupt von solch furchtbaren Sachen, die unsere innere Harmonie aus dem Gleichgewicht bringen?
Wenn ich zurückblicke und an mein eigenes Leben denke, dann habe ich in einer Zeit gelebt, in der es eine breite Schicht von Menschen relativ leicht gehabt hat – in Amerika. In einem solchen Middle-Class-Leben kaufte man sich ein Auto, eine Wohnung, Air-Con, machte Urlaub. Eine große Masse der Menschen brauchte keine Erfahrungen damit zu machen, was es bedeutet, zu hungern. In dieser Zeit haben meine Frau und ich Kinder bekommen. Die Kinder mußten nichts für das Essen tun, es gab keinen Kampf ums Dasein. Die Welt war da, und lieferte das, was man haben mochte. In der Universität habe ich gesehen, daß Kinder keinerlei Noterfahrung mehr gemacht haben. Daraus beginnen die Kinder zu extrapolieren für das eigene Leben: Man braucht sich nicht zu bemühen. Vielleicht in anderen Teilen der Welt, in Indien und Afrika, dort gibt es Hunger, aber das hat nichts mit ihnen zu tun. Sie haben die Erfahrung, daß es entscheidend ist, welche Art von Turnschuhmarke diejenige ist, die in der Schule getragen werden sollte.
Diese Generation ist jetzt erwachsen. Die haben nicht gelernt, hinter die Kulissen zu gucken, weil vieles zu leicht war. Am MIT beispielsweise, der Universität, an der ich lehre, gibt es eine ganze Menge Studenten, die wußten bereits mit 10 Jahren, daß sie an dieser Hochschule studieren werden. Sie hat einen sehr guten Ruf, die Studenten werden sorgfältig ausgewählt. Das heißt, die Kinder mußten gute Noten bekommen, weil Daddy wollte, daß sie am MIT studieren. Sie produzieren die guten Noten, überstehen das Auswahlverfahren. Nun kommen junge Menschen an diese Hochschule, die niemals in ihrem Leben gescheitert sind, die immer zu den besten 5% ihres Jahrgangs gehörten. Am MIT treffen sie nun auf ihre Konkurrenz, und plötzlich sehen sich viele von ihnen Scheitern, erleben Enttäuschung und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, weil es ihre bisherige Erfahrung übersteigt.
Z: Wie läßt sich das, was mit solchen Erfahrungen verbunden ist, in unsere Leben holen, ohne jemanden zum Hungern zu zwingen oder eine andere Notsituation zu erzeugen?
W: Früher sind Leute mit dem Peace-Korps nach Afrika geschickt worden. Die wissen, was Not ist, die nehmen persönliche Unbequemlichkeit in Kauf, weil sie nicht einfach den Wasserhahn aufdrehen können, um zu trinken. Sie fragen nach einer Lösung, aber eine einfache Lösung gibt es nicht. Viel hängt von den Eltern ab und was die Kinder von ihnen mitbekommen haben. Als meine Kinder zur Schule gegangen sind, wohnte ich in Concord, Massachussetts. Das ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort, weil dort der erste Schuß der amerikanischen Revolution abgefeuert wurde. Wir wohnten in einer Gegend, Upper-Middle-Class, in der die meisten Menschen aufstrebten, auf dem Weg nach oben waren. Meine Frau war mit einer anderen Frau befreundet, die sechs, sieben Häuser weiter wohnte. Ihr Mann arbeitete in einer Rüstungsfirma. Er war dreiviertel der Zeit im Jahr unterwegs, weltweit. Er hat an der Einrichtung von Raketen mitgearbeitet und die Leute mit ausgebildet, die sie bedienen sollten. Ich habe keine Ahnung, was er seinen Kindern geantwortet hat, wenn sie ihn fragten, womit er eigentlich sein Geld verdiente. Doch die Familie war intakt, niemand brauchte Hunger zu leiden. Aber was haben die Kinder gelernt über die Schwierigkeiten in der Welt und darüber, was Papa macht. Es war leicht, ein Tag nach dem anderen.
Wo sollen Kinder etwas lernen, wenn nicht zu Hause? Für den Raketeningenieur ergeben sich zwei Möglichkeiten: Entweder er erklärt es einfach nicht, was er da macht oder er erklärt mit großer Selbstverständlichkeit, dies sei ein ganz normaler Job, und findet, daß diese Massenmordmaschinen ganz in Ordnung seien.
Z: Herr Weizenbaum, ich danke Ihnen für das Gespräch.