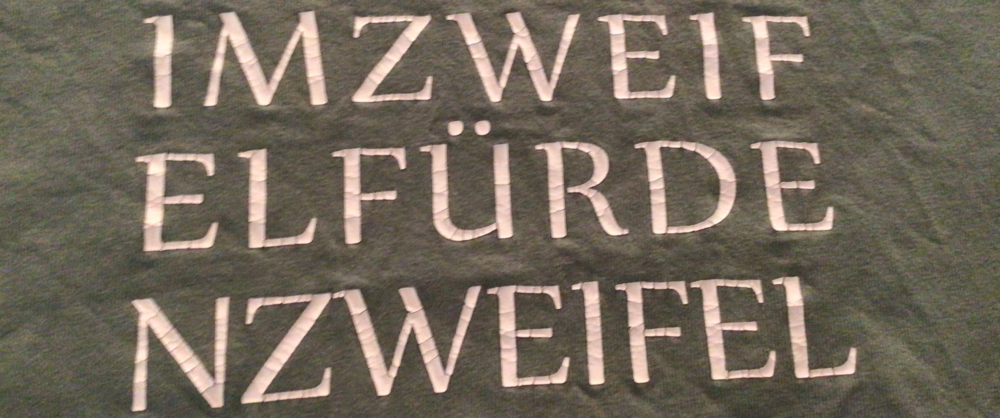In der öffentlichen Diskussion um die Zwei-Klassen-Medizin wird zweifelsfrei vorausgesetzt, dass es irgendwie besser wäre, privat versichert zu sein: Ein privat Versicherter bekomme angeblich eher einen Arzttermin, habe Zugang zu den besseren Medizinern, den besseren Therapien und werde insgesamt im System bevorzugt behandelt.
Dieser rosige Blick auf die Wirklichkeit der privaten Krankenversicherung (PKV) dient vor allem einem Zweck: Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) wegen ihrer vermeintlich schlechteren Versorgung abzuwerten. Seht her, wie gut es dem privat, wie schlecht es dem gesetzlich Versicherten geht. In den vergangenen Wochen hat sich niemand zu Wort gemeldet, der darauf hinweist, dass es sich bei der Bevorzugung privat Versicherter um (häufig) unnütze Überversorgung handelt. Im letzten Jahr berichteten die Zeitschrift Capital und die FAZ – In den Klauen der Halbgötter aus journalistischer Sicht über das Phänomen.
Ein Blick auf die Rahmenbedingungen genügt, und vom schönen Schein der PKV bleibt nicht mehr viel übrig. Alles fängt bei der Risikoprüfung an, die ein Wesensmerkmal dieser Krankenversicherung ist. Wer krank ist, alt oder mit einem anderen Malus behaftet, zahlt höhere Beiträge oder wird gleich abgelehnt. Wenn nicht der Beamtenstatus eine Privatkasse dazu verleitet, denjenigen zu versichern. Eine psychische Erkrankung in der Vorgeschichte kann zu einem gesenkten Daumen seitens der PKV führen. Daraus resultiert eine insgesamt, im Vergleich zur GKV, gesündere Versicherten-Population. Seit dem 01.07.2007 ist es gleichwohl möglich, ohne Risikoprüfung in die PKV aufgenommen zu werden bzw. zurückzukehren.
Dass allerdings diese eher gesünderen Patienten in einer Studie Qualität der Gesundheitsversorgung in Deutschland berichteten, sie gingen häufiger zum Facharzt, würden häufiger stationär behandelt und häufiger nicht-akut-notwendigen OPs ausgeliefert, verwirrt dann doch. Außerdem bekamen privat Versicherte in der Studie, an der das IQWiG beteiligt war, häufiger unnötige Doppeluntersuchungen, warteten kürzer sowohl bei den Fachärzten als auch bei geplanten Operationen. Da schließt sich der Zwei-Klassen-Medizin-Kreis: Weil es sich um die lukrativeren Patienten handelt, werden sie zwar bevorzugt behandelt, kommen deswegen gleichwohl in den Genuss möglicherweise unnützer Überversorgung.
Doch zu viel des Guten reicht nicht. Die PKV erstattet den behandelnden Ärzten immer wieder Heilversuche, die allenfalls dem Geldbeutel des Behandlers dienen kaum aber dem Patienten. Lucentis bei trockener Makula-Degeneration (MD) ist ein nicht unbeliebter Versuch von Augenärzten, ihren privatversicherten Patienten, die ihren Blick nicht mehr scharf stellen können, Hoffnung zu verticken. Was für die feuchte, die altersbedingte MD erlaubt ist, kann doch für die trockene nicht so falsch sein! Eine Zulassung jedoch gibt es für diese Indikation nicht.
Doch nicht nur Überversorgung ist problematisch bei der PKV. Auch Unterversorgung ist zu vermelden, bspw. in der Versorgung von schwangeren Frauen und Wöchnerinnen. Geburtsvorbereitungskurse werden nicht erstattet. Und Wöchnerinnen stellt die PKV keine Haushaltshilfe zur Verfügung, wie die GKV es tut, auch nicht, wenn der Bedarf erwiesen ist. Auch finanziert die PKV keine Rückbildungsgymnastik. All das gehört zum Privatvergnügen der Schwangeren. Schwangerschaft sei eben keine Krankheit.
Zum Schluss noch eine Bemerkung zum Versicherungsbeitrag. Die PKV nimmt in der Regel weniger Beitrag als die GKV (Arbeitnehmer- plus Arbeitgeberanteil). Dafür allerdings gibt es in der PKV die Versicherung von Familienmitgliedern nur gegen Aufschlag oder gar einen eigenen Beitrag.
Wer die GKV also nur an der Höhe des Beitrages bemisst, sollte nicht zur Seite schieben, was es dafür gibt: In einer vierköpfigen Familie, in der nur einer verdient, zahlt auch nur einer Beitrag – zumindest so lange die Eltern verheiratet sind. Aber das ist eine andere, eine familien-, keine gesundheitspolitische Baustelle…